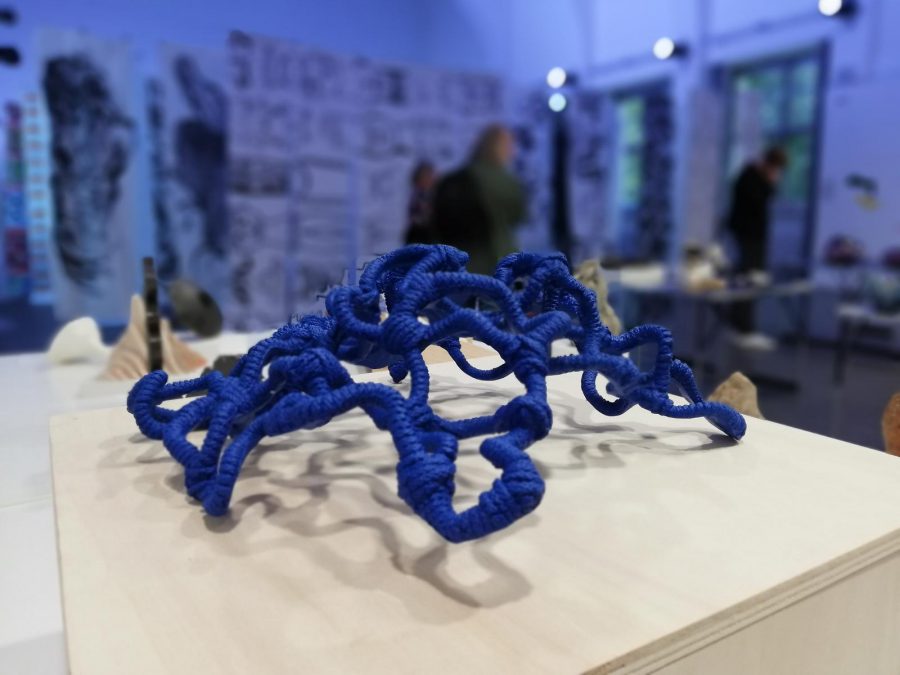Wenn man sich erst einmal die simple Formel vergegenwärtigt hat, wonach alte Menschen tendenziell zurück, junge dagegen nach vorn schauen, erscheint es konsequent: Zwar ist es langsam nicht mehr wegzudiskutieren, dass die Erde angesichts fortschreitender Erwärmung ihren Charakter verändert. Aber deshalb gleich einen Aufstand anzetteln? Man hat schließlich schon ganz andere Sachen überlebt.
Man kann Warnungen als Hysterie abtun. Man kann aber auch noch ein paar weitere Jahre nichts tun, abwarten, zuschauen. Und sich dann eventuell wundern, dass doch alles schneller als erwartet ging. Man kann das als Generationenkonflikt betrachten. Oder eben auch nicht.
Denn wann immer eine „Generation“ aus dem Hut gezaubert wird, sollte man mindestens so skeptisch sein wie manche Verblendete es in Bezug auf die globale Erwärmung sind. Denn noch nie war eine Generation, ob nun mit X, Y, Golf, Praktikum oder Z etikettiert, so homogen, dass ein Versuch, dem Ganzen einen passenden Stempel zu verpassen, wirklich Sinn ergeben hätte. Selbst die 68er-Generation hatte – zu einer Zeit also, als es noch wirklich fundamentaler gesellschaftlicher Veränderungen bedurfte, um begründet von einer Generation zu sprechen – nicht nur den Konflikt mit ihren Altvorderen auszutragen. An anderer Front galt es, sich mit der Mehrheit der unpolitischen Gleichaltrigen auseinanderzusetzen.
Fridays for Future sind unerwartet viele, allerdings auch keine Mehrheit. Eine weitere Parallele zur 68er-Generation: Ihr Thema hat ähnliche, sehr wahrscheinlich sogar größere Dimensionen als die Probleme der 68er.
Die Dringlichkeit, sich mit dem Thema Klimawandel zu befassen, wurde im Laufe der letzten Jahre ja nun wirklich nicht geringer. Im Gegenteil wurde durch jahrzehntelange Ignoranz der Entscheider in Wirtschaft und Politik, aber natürlich auch weiter Teile der Bevölkerung, sehr viel Zeit von der Uhr genommen, was den Handlungsspielraum mittlerweile stark einengt. Wen wundert es, dass irgendwann mehr Leute als die sonst üblichen Verdächtigen auf die Straße gehen und versuchen, noch etwas zu retten, wo eventuell weniger zu retten ist als man sich das momentan noch erhofft?! Die Last auf den jungen Protestierenden ist immens: Endzeitstimmung vor Augen haben, aber Aufbruchstimmung erzeugen müssen. Man darf daher gespannt sein, wann die Stimmung in Resignation umschlägt und was dann geschieht.
Und auch wenn die Adressaten der wütenden Anklagen von FFF die älteren Generationen sind – die Konfliktlinien verlaufen nicht entlang von Geburtsjahrgängen, sondern von Aufgeschlossenheit gegenüber dem Thema. Mancher ältere, der die ärgsten Auswüchse des Klimawandels nicht mehr miterleben dürfte, aber seit Jahrzehnten aus Überzeugung mit dem Rad fährt, ist näher dran an der Bewegung als der 18-jährige Mitschüler, der für ein Wochenende zur Selbstverwirklichung mit dem Billigflieger nach Barcelona jettet, was für das Klima ein teuer bezahlter Spaß ist. Die Angehörigen der Generation EasyJet hatten eben bis jetzt einfach noch nicht genügend Zeit, ihren ökologischen Fußabdruck dermaßen nachhaltig zu versauen, dass man es ihnen schon genauso vorwerfen könnte wie den Älteren.
Wie mehr oder weniger alle Generationen vor ihnen, sind demnach auch die aktuell auf die Straße gehenden Jahrgänge eine gespaltene Generation.
Noch unübersichtlicher wird die Gemengelage, wenn man berücksichtigt, dass sich unter dem Label FFF streng genommen zwei verschiedene Generationen vermengen: Die jüngeren Angehörigen der Generation Y treffen auf den älteren Teil der Generation Z.
Über die Generation Y meint man zu wissen, dass sie wie kaum eine andere Generation in Bildung investiert, weil diese der Garant für einen vernünftigen Arbeitsplatz ist. Da die Firma, in der ich seit einiger Zeit im Lager arbeite, viele studentische Aushilfen beschäftigt, habe ich in den letzten fünfeinhalb Jahren etliche junge Menschen kennenlernen dürfen, manchmal aber auch müssen, die sich anschicken, in den nächsten Jahren die Schlüsselpositionen dieser Gesellschaft zu besetzen. Ich muss gestehen: Das macht mir eher Angst als Mut. Vor allem konnte ich aber auch folgendes Geheimnis bislang nicht enträtseln: Wenn lebenslanges Lernen für diese Jahrgänge selbstverständlich ist – weshalb wird dieser Prozess dann von so vielen ausgerechnet bei uns unterbrochen?
Muss man sich also schon sehr anstrengen, wenn man die Ypsiloner überhaupt wahrnehmen will, gilt ähnliches auch für die Vertreter der Generation Z. Und die Angehörigen beider genannter Generationen sind keineswegs alle umweltbewegt, sondern genauso hedonistisch wie die Generationen vor ihr. Generationenübergreifend größtes Hobby scheint zu sein, den halben Tag Serien auf netflix anzuschauen. Die andere Hälfte des Tages wird damit verbracht, sich mit Anderen über das Gesehene zu unterhalten. Die Zukunft wird thematisiert, wenn es darum geht, welche Serie als nächstes angeschaut wird, nicht aus Sorge ums Klima. Das interessiert bestenfalls am Rande. Am Rande bemerkt sei übrigens: Videostreaming verbraucht jährlich so viel CO2 wie Spanien.
Und als ob fehlende klimapolitische Weitsicht bei Altersgenossen wie Älteren nicht schon ausreichte, muss man sich als Aktivist zusätzlich noch rechtfertigen, warum man nicht auch noch dieses oder jenes zur Rettung des Planeten unternehme. Von Leuten wohlgemerkt, die ihre Finger in Sachen Dekarbonisierung nur rühren, um mit ihnen auf andere zu zeigen, weil die ja auch viel Dreck machen. Doch so funktioniert die Rettung des Planeten nicht.
Es wird Zeit, den Spieß langsam umzudrehen und den Rechtfertigungsdruck auf diejenigen zu erhöhen, die weiteres Zusehen als adäquate Reaktion auf die vielfach belegten und sichtbaren Veränderungen halten, weil „wir“ schließlich nicht sämtliche Probleme der Welt lösen können. Auf dem Klima-Index von Germanwatch liegt Deutschland mit seinen Bemühungen auf dem 23. Platz. Soviel zur Behauptung, dass „wir“ die Probleme der Welt lösen. Wenn man betrachtet, welche Alpträume bereits die bloße Möglichkeit eines Tempolimits auf Autobahnen auslöst, mag man sich das Theater besser nicht vorstellen, das hierzulande los ist, wenn man irgendwann tatsächlich mit deutlichen unfreiwilligen Einschränkungen bei den drei Lieblingshobbys Autofahren, Reisen und Fleischessen leben muss.
Aber so ist das eben – mit dieser Generation und mit allen anderen: Meldungen, die die eigene Meinung bestätigen, werden ungeprüft als richtig eingestuft. Deshalb nimmt mancher an, man würde durch demonstratives Verzichten auf nichts tatsächlich einen relevanten Beitrag leisten. Deshalb lässt das unreflektierte Weiterverbreiten von offensichtlichen fake news bereits auf das Weltbild des Teilenden schließen. Soweit die schlechte Nachricht.
Die gute Nachricht lautet jedoch: Bislang lassen sich die Aktivisten wenig beeindrucken. Nicht davon, dass die Gegenseite der Klimaleugner ihre Geschütze längst in Position gebracht hat. Nicht davon, dass sie noch auf absehbare Zeit mit einer desillusionierenden Ignoranz weiter Teile der Bevölkerung zu rechnen haben. Nicht davon, dass ihnen von prominenten Politikern, die dazu beigetragen haben, dass es überhaupt so weit kommen konnte, die Urteilsfähigkeit ob ihres Alters abgesprochen wird.
Alles das verdient meine Hochachtung.