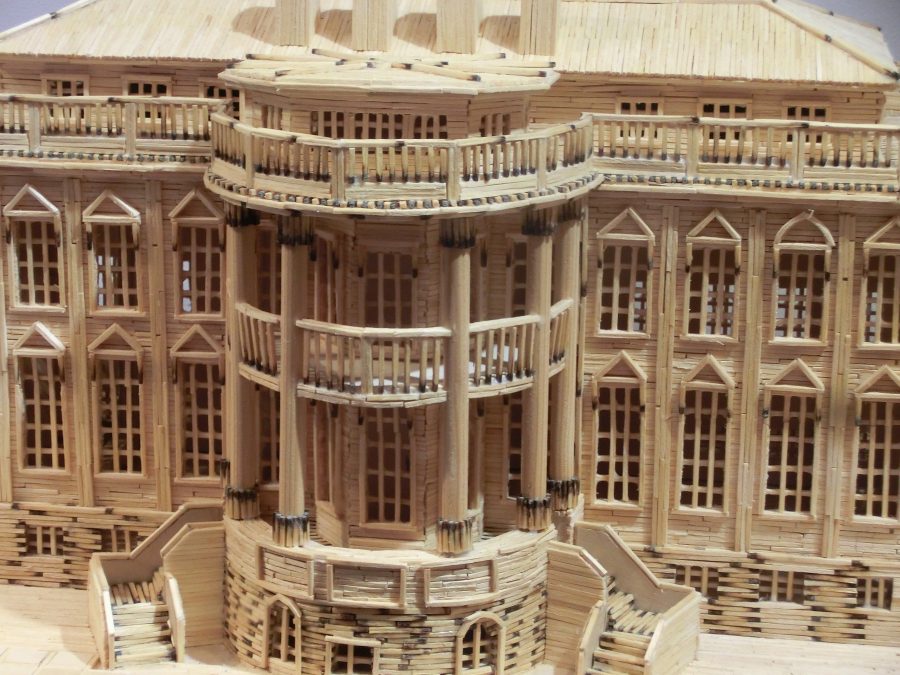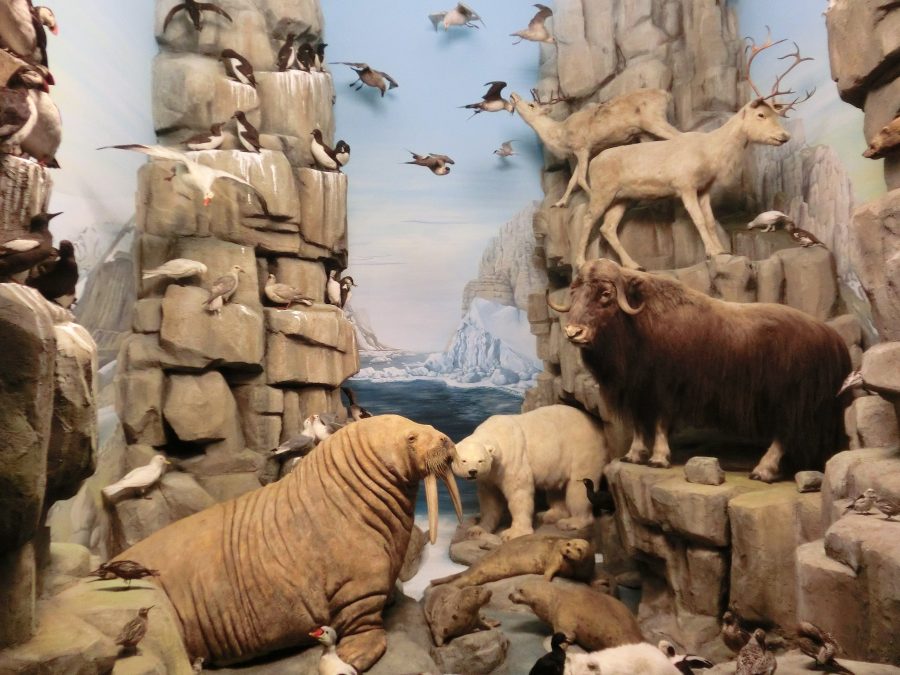Wäre das Kalenderjahr ein Fußballspiel, würden die ersten Zuschauer etwa ab Anfang Dezember ihre Plätze Richtung Ausgang verlassen, weil sie vom Rest der Spielzeit ohnehin keine entscheidenden Veränderungen mehr erwarten. In welcher Stimmung man dies tut, hängt in großem Maß von der Differenz des Spielstandes zu den Erwartungen ab. Und auch dass böse oder angenehme Überraschungen den bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Gesamteindruck wider Erwarten noch einmal ändern können, gehört zum Spiel des Lebens dazu. Nichtsdestotrotz: Sobald die ersten Glühweinmärkte eröffnen, kann man sich eigentlich sicher sein, dass der Einzelne nicht mehr allzu viel Energie investieren wird, um den Ausgang des Jahres nochmal in größerem Maß zu beeinflussen. In diesem Sinne: Willkommen zu meiner höchst subjektiven Jahresbilanz!
Dabei wird sich das erste Mal in der Geschichte des Meilensteinbildhauers ein Thema über drei Blogeinträge erstrecken. Die einzelnen Bestandteile werden sich natürlich auch sehr gut als eigenständige Texte lesen lassen, allerdings gibt es eben eine Klammer, welche die einzelnen Beiträge zusammenhält.
Vorausgesetzt, im letzten Zwölftel des Jahres passiert tatsächlich nicht mehr viel, werden vom gerade ablaufenden Jahr am Ende zwei Dinge bleiben, die man als echte Meilensteine bezeichnen kann. Für den einen kann ich nicht einmal etwas. Der ist einfach so passiert, war aber trotzdem intensiv. Von ihm wird in Halbzeit 1 die Rede sein. Der zweite persönliche Höhepunkt – Halbzeit 2 -, der nächste Woche Gegenstand der Betrachtung sein wird, war dann schon eher Ergebnis zielgerichteten Vorgehens meinerseits. Und da nach einem Rückblick irgendwie auch ein Ausblick erwartet wird, soll es in der Mixed Zone, dem dritten Text darum gehen, worauf ich oder wir uns im nächsten Jahr freuen, ärgern oder wundern dürfen oder sollen.
Halbzeit 1: Mein Tor des Jahres
Auf eine Erwähnung des Endspiels um den DFB-Pokal wird kein seriös sich bezeichnender Jahresrückblick verzichten können. Angetreten waren:
Auf der einen Seite der FC Bayern München. Das sind die, bei denen im TV immer gern der Präsident ´reingeschnitten wird, wenn es ´mal nicht so gut läuft, weil man diesem Mann seinen Missmut darüber, dass es nicht so gut läuft, immer so schön ansieht. Zuverlässige Anzeichen, dass es nicht so gut läuft beim FCB, ist regelmäßig, wenn in der Tabelle der Liga irgendein Verein oberhalb des FC Bayern steht. Dann wird Jupp Heynckes angerufen und ihm die Bitte vorgetragen, den Saustall zu übernehmen, und dann wird alles gut.
Auf der anderen Seite die SG Eintracht Frankfurt, deren größte Erfolge in den vergangenen Jahrzehnten Aufstiege aus der 2. Liga sowie gerade noch so verhinderte Abstiege dorthin gewesen sind. Die aktuelle Bundesligasaison wurde eine Woche vor dem Pokalfinale auf dem 8. Platz beendet, in etwa also dort, wo man günstigstenfalls hingehört. In einer Vorschau auf das Endspiel hatte ich irgendwo die überaus realistische Einschätzung gelesen, dass meine Eintracht mit Ante Rebic lediglich einen Spieler besitzt, den man sich von der Qualität auch im Kader des Gegners vorstellen kann.
So weit also zu den ungefähren Kräfteverhältnissen in dieser ungleichen Begegnung. Der Verein meines Herzens war gegen den Abonnement-Meister aus München also nicht direkt als Favorit ins Rennen gegangen.
Besagter Ante Rebic war es dann auch, der die Eintracht zweimal in Führung schoss. Dass er hinterher zu Recht als Pokalheld im Gedächtnis bleibt, verdeckt leider ein bisschen diesen genialen Moment des dritten Tores, das Mijat Gacinovic am Ende noch zum verdienten Pokalsieg beigetragen hat:
Das Ende der Nachspielzeit. Bayerns Schlussmann war in dieser Phase bei eigenem Ballbesitz natürlich bereits mit nach vorne geeilt, um in diesen letzten Sekunden die Möglichkeit eines Ausgleichs zu erhöhen. Und plötzlich fiel bei einem dieser Angriffe des Rekordmeisters ein Spieler von denen von einem der unseren getroffen um, und alle warteten nun darauf, dass der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigt, dieser Strafstoß sicher verwandelt würde, die ganze Angelegenheit in die Verlängerung ging, in der das Spiel letzten Endes selbstverständlich zugunsten des FCB entschieden würde und man sich der unangenehmen Frage stellen müsste, weshalb man so dumm gewesen war, anzunehmen, gegen den großen FC Bayern könnte tatsächlich mehr gehen als über weite Strecken des Spiels gut mitgehalten zu haben.
Der Schiedsrichter ging zum Monitor am Spielfeldrand und sah sich die strittige Szene an, hatte seine Entscheidung offenbar getroffen, wandte sich ein weiteres Mal dem Bildschirm zu. Eine quälend lange Zeit, während der man sich der Naivität eben geschilderter Hoffnungen auf einen guten Ausgang bewusst werden konnte. Aber die Dynamik des Spiels hatte die Erwartungen verändert, an denen gemessen es bei einer 2:1-Führung bis in die Nachspielzeit inzwischen kein Erfolg mehr wäre, den Deutschen Meister in die Verlängerung dieses Spiels zu zwingen.
Der Unparteiische kehrte auf das Spielfeld zurück und entschied auf Eckstoß. Empörung auf der einen, Aufatmen auf der anderen Seite. Aber die Gefahr des späten Ausgleichs war nach wie vor gegeben, und zwar bis der junge Gacinovic den herausgeköpften Ball an der eigenen Strafraumgrenze erhielt und sich auf und davon machte. Jetzt aber! Das Bayern-Tor war ja leer. Allerdings auch noch runde 70 Meter entfernt. Keine Distanz, aus der man ´mal eben draufhält.
Acht Sekunden für die Ewigkeit
In japanischen Zeichentrickserien würde die Dramaturgie ab hier einen mehrere Minuten währenden Lauf auf das Tor vorsehen. Dass es in der Realität nur etwa acht Sekunden von einem Strafraumende zum anderen waren, hat an diesem 19. Mai wahrscheinlich einige Fans vor akutem Herzversagen bewahrt.
Man mag hinterher besser wissen, dass ein 2:1 genauso zum ersten Pokaltriumph seit exakt 30 Jahren gereicht hätte. Aber in diesen acht Sekunden denkst Du als Fan – ob vor Ort im Stadion oder vor der Glotze – doch nur an ein Stolpern, ein ordinäres Tackling, einen Pfostenschuss, der dem Gegner doch nochmal eine diesmal allerletzte Möglichkeit des Angriffs ermöglichen würde. Dann würde es hinterher wieder heißen, die Eintracht sei dem späteren Pokalsieger durchaus auf Augenhöhe begegnet. Und dieses Urteil mag schmeicheln, aber wieder einmal mit leeren Händen dazustehen und allein das Erreichen dieses Endspiels schon als Erfolg zu feiern, wäre verdammt ungeil. Wie viele Mal geiler wäre es, endlich wieder ´mal einen Titel zu haben? Und deswegen wurde mit jedem zurückgelegten Meter auf das verwaiste Tor der Puls abartig schneller.
Acht Sekunden. Die komplette Ersatzbank läuft an der Seitenlinie mit ihm, weil es sie genauso wenig auf ihren Sitzen hält wie irgendeinen Eintracht-Anhänger vor dem Fernsehgerät. Und irgendwann ist das Ding drin und das Spiel entschieden. Acht Sekunden für die Ewigkeit.
Ein Pokalsieg der Eintracht wäre natürlich nicht weniger wert gewesen, wenn sie eine ordinäre 3:0-Führung ab der 70. Minute verwaltet hätten. Aber dann wäre die Freude darüber in anderen Bahnen verlaufen. So aber hatte sie acht Sekunden Zeit, sich aufzubauen, um sich schließlich ungeordnet zu entladen, als sicher war, dass der Ball im Kasten des Gegners versenkt ist. Das sind Momente, für die Fußball so geliebt wird.
Die Sache hatte natürlich auch irgendwo einen Haken. Denn die Spieler des FCB waren maximal angepisst. Die Differenz des Ergebnisses zu ihren Erwartungen hatte zu einem negativen Wert geführt. Die waren so angepisst, dass die meisten von ihnen sogar vergessen haben, ihre Medaillen für den 2. Platz zu entsorgen. Ein einziger hat seinen Orden noch rechtzeitig vor der Flucht in die Kabine ins Publikum geschmissen. Was soll´s – bis zur neuen Saison würden die schon wieder zur gewohnten Form finden…
Was kann man daraus lernen?
Da das Kalenderjahr kein Fußballspiel ist, bleibt einem regelmäßig wenigstens die Verlängerung erspart. Andererseits hat man durch diese fehlende Option auch keine Möglichkeit, ein durchwachsenes Jahr noch zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen, wenn man das in der regulären Spielzeit eines Jahres unterlässt.
Also legt Euch ins Zeug! Vier Wochen habt Ihr noch, um eine Ergebniskorrektur vorzunehmen..!